Megatrend Künstliche Intelligenz
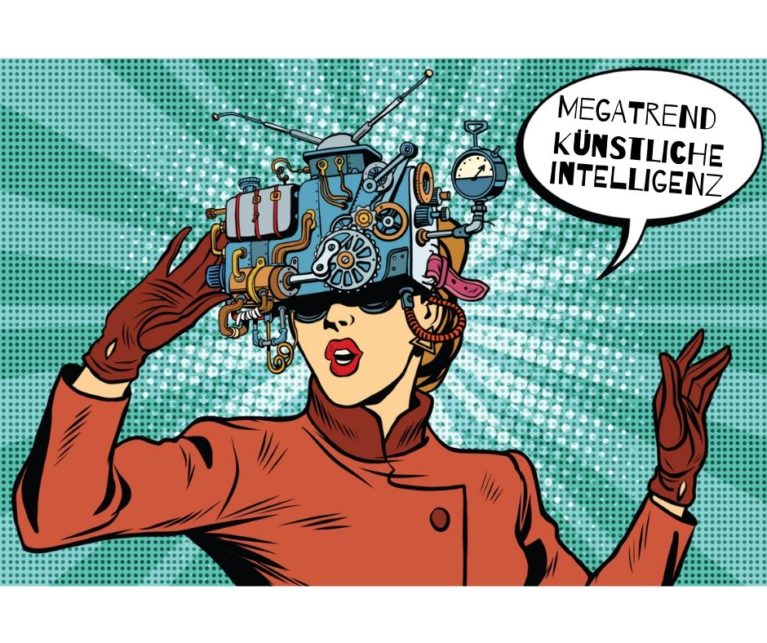
shutterstock_437640805
Sprachassistenten wie Alexa oder Siri sind vertraute Stimmen, Robo Wunderkind bringt spielerisch die Grundlagen des Programmierens bei: Für immer mehr Kinder ist künstliche Intelligenz (KI) heute Alltag.
Künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem Maschinellen Lernen, also der künstlichen Generierung von Wissen, befasst.
Das Ziel ist eine sogenannte starke KI, das menschliche Denken zu mechanisieren, bzw. eine Maschine zu konstruieren und zu bauen, die intelligent reagiert oder sich eben wie ein Mensch verhält. Sie soll über eine Art Bewusstsein verfügen, Strategien lernen, Emotionen empfinden und in der unsicheren Realität bestehen.
Die großen Durchbrüche, auf die man in den 1960ern hoffte, lassen noch auf sich warten. Der technische Fortschritt entwickelt sich wie die Evolution meistens nicht linear. So ist es bis zur omnipotenten Superintelligenz, zudenkenden Computer und zu völlig autonomen Robotern noch ein weiter Weg.
Bis dahin können wir die Errungenschaften sogenannter „Weak Artificial Intelligence“ (schwache künstliche Intelligenz, AI) beobachten. Hier können Maschinen in einem sehr kleinen Ausmaß Entscheidungen treffen und sich dabei hochkonzentriert klar eingegrenzten Aufgaben widmen. Sie schreiben Programme, die für konkrete Probleme die besten Lösungen finden – sei es die Spracherkennung oder die Suche nach dem passenden Bild – sie vervollständigen laufend unsere Suchanfragen, löschen Spam aus unserem Postfach, regeln den Thermostat selbstständig oder spielen Schach wie ein Weltmeister. Zwar klingt „weak AI“ nicht gerade nach einem Kompliment, dennoch ist es so dass sich möglicherweise gerade die „weak AI“ zu der für uns interessantesten und hilfreichsten Form der künstlichen Intelligenz entwickelt. Immerhin wird es nicht in unserem Interesse sein, wenn selbstfahrende Autos schlagartig den Sinn den Lebens hinterfragen oder der virtuelle Assistent uns plötzlich sabotiert, weil er uns nicht mehr mag.
Spätestens mit der zweiten Automatisierungswelle scheint unsere geistige Kraft wirtschaftlich nicht mehr wirklich gebraucht zu werden. Dies wirft große gesellschaftspolitische Fragen auf und wird auch zum zentralen Punkt in der Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Noch viel wesentlicher als der finanzielle Aspekt wird in diesem Zusammenhang das Element der Selbsterfüllung: Wie verwirklichen wir uns, sobald Maschinen uns in allen Disziplinen überlegen sind?
Viele sehen künstliche Intelligenz als die letzte Erfindung der Menschheit, die existenzielle Probleme des 21. Jahrhunderts lösen wird und allumfassenden Wohlstand bringt.
Gegner hingegen fürchten sich davor dass die Entfaltung der KI über kurz oder lang die gesamte Menschheit bedrohen wird.
Hier ein paar Trends im Bereich der künstlichen Intelligenz:
AFFECTIVE COMPUTING:
Während auf der einen Seite die Maschinen vornezu schlauer werden, fehlt ihnen auf der anderen Seite die emotionale Intelligenz, also die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle (korrekt) wahrzunehmen, zu verstehen und zu beeinflussen.
Genau diese emotionale Intelligenz ist das Kernelement des „Affective Computings“. Das Forschungsgebiet sammelt Daten aus Gesichtern, Stimmen und Körpersprache um menschliche Emotionen zu messen und diese Information wiederum zur Verbesserung des bereitgestellten Dienstes zu verwenden. Maschinen werden also empathisch und emotional.
So kann Affective Computing Ärzten in ihrer Arbeit helfen und die Stimmung eines entfernten Patienten schneller verstehen oder diesen auf Anzeichen von Depressionen untersuchen. Call-Center-Agenten bekommen schon heute Hilfe von der Maschine:Diese analysiert Veränderungen in Tonlage und Sprache und gibt Tipps für einen optimalen Gesprächsverlauf.
Affective Computing wird in Zukunft in dem Gebiet des Human Resource Management (HRM), Marketing und Entertainment immer stärker genutzt werden.
Zum Beispiel wird eine ausgefeilte Sensorik in Smartphones eine noch präzisere Aufzeichnung von Verhalten und Bewegungsmustern erkennen können. Diese Daten sollen dabei unterstützen um eine noch verbindlichere Kundenbeziehung aufzubauen.
CHATBOTS
Chatbots sind Applikationen, die per Textnachricht mit dem Nutzer interagieren. Sie unterstützen beispielsweise Kundenservice Mitarbeiter und sorgen für ein verbessertes Kundenerlebnis. Das Ziel hier ist eine verbesserte Konversionsrate, also die Umwandlung eines Interessenten in einen Kunden, die Registrierung für einen Newsletter oder das Ausfüllen von Angebotsanfragen. Chatbots bieten Hilfe bei einfachen Fragestellungen. Sie zeigen sich aktuell als vielfältiges Kommunikationsinstrument und werden auch im Marketing oder als Sprachtrainer eingesetzt.
INTELLIGENT PERSONAL ASSISTANT
Wer Iron Man gesehen hat, weiß um die Fähigkeiten von Jarvis. Sie ist eine von Tony Stark entwickelte künstliche Intelligenz, die sowohl sein Haus, als auch all seine Rüstungen kontrolliert. Jarvis befindet sich jedoch bereits in der Königsklasse der künstlichen Intelligenz, denn Sarkasmus ist eine seiner programmierten Eigenschaften.
Obwohl wir noch sehr weit weg von der Jarvis-Vision sind, so können mit der steigenden Computerleistung Chatbot-Systeme immer schneller auf umfangreiche Datenbestände zugreifen und daher auch intelligente Dialoge für den Nutzer bieten. Solche Systeme schaffen es die Kommunikation mit der Technik in eine Form zu bringen, mit der wir Menschen uns wohl fühlen: in die Form eines Gespräches, in der Anwendungen dabei eine Stimme oder sogar ein Gesicht erhalten.
COGNITIVE COMPUTING
Cognitive Computing nutzt die Künstlichen Intelligenz, um menschliche Denkprozesse zu simulieren.
Während KI Systeme Aufgaben durch den Einsatz der am Besten geeigneten Algorithmen erledigen, ermitteln kognitive Computersysteme Strategien zur Problemlösung, ohne die Ergebnis selbst zu kennen. Durch die Nachahmung des menschlichen Gehirns werden Computer lernfähig und können so selbständig komplexe Aufgaben lösen.
Cognitive Computing trifft keine Entscheidungen, sondern unterstützt den Menschen bei der Entscheidungsfindung. Für das Resultat ist daher der Mensch verantwortlich.
Das Ziel des Cognitive Compuing ist die Schaffung selbständiger, lernender Systeme die in der Lage sind menschliche Aufgabenstellungen ohne vorab strukturierte Informationen zu lösen.
Die Einsatzfelder sind ganz unterschiedlich: Aktuelle Projekte bei der Allianz, bei denen künstliche Intelligenz genutzt wird, umfassen unter anderem die Betrugsaufdeckung. Spracherkennung und Roboter mit natürlichen Sprachfähigkeiten werden zur Bearbeitung von Schadensfällen eingesetzt.
zum Beispiel werden autonome Roboter entwickelt, die eigenständig in der Lagerverwaltung und Produktion oder Logistik eingesetzt werden und keine menschliche Unterstützung mehr benötigen.
In der Medizin kommt das Cognitive Computing in der Diagnostik zum Einsatz und hilft dem Arzt bzw. der Ärztin bei der Bestimmung von Krankheiten und den Therapiemöglichkeiten. Ein Mediziner kann neben seiner Tätigkeit vielleicht zehn Veröffentlichungen in einem Monat lesen. Ein kognitiver Rechner liest dagegen etwa eine Million solcher Dokumente in 30 Sekunden. Diese umfangreiche Information unterstützt dabei in Echtzeit aus riesengroßen medizinischen Datenbanken eine Diagnose und die folgende Therapie zusammenzustellen.
(Autorin: Martina Hagspiel / ÖGV)